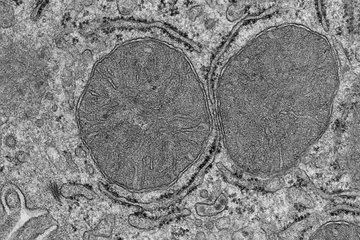Länger fit mit Schneewittchen?
Gute Großeltern können von ihrem Engagement selbst profitieren
Oma liest Märchen vor, Opa reist um die Welt: Das Verhältnis zu den Enkelkindern definiert jeder selbst. Der Psychologe Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, erklärt im Interview, wie solche Entscheidungen zustande kommen, wie sich die Fähigkeit dazu mit dem Alter verändert und welche Auswirkungen sie auf Glück und Gesundheit haben.

Herr Hertwig, ist es wahr, dass gute Großeltern länger leben?
Das wäre schön, wenn wir in der psychologischen Forschung so eindeutige Beziehungen herstellen könnten. Noch dazu solche mit einer so herzerwärmenden Moral. So einfach ist es in der Regel leider nicht. Was sich in unseren Studien aber immer wieder bestätigt, sind enge Zusammenhänge zwischen Wachheit im Alter, geistiger Beweglichkeit und den Lebensumständen – nicht zuletzt den selbst gewählten. Und es gibt in der Tat Hinweise darauf, dass Großeltern, die sich mit ihren Enkelkindern beschäftigen, eine längere Lebenszeit haben als ältere Menschen, die keine Enkelkinder haben, oder als Großeltern, die — aus welchen Gründen auch immer — sich nicht um ihr Enkelkind kümmern.
Woran liegt das?
Sich zu kümmern hat viele Dimensionen. Die Forschung konnte immer wieder belegen, dass kognitive Herausforderung und soziale Interaktion besonderen Einfluss auf die Entwicklung im Alter haben: auf die allgemeine Zufriedenheit, auf intellektuelle Leistungsfähigkeit, vermutlich auch auf die physische Gesundheit. Und das muss keineswegs auf leibliche Großeltern beschränkt sein. Sehen Sie, wir haben am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin die wunderbare Möglichkeit, mit den Datensätzen der Berliner Altersstudie (BASE) zu arbeiten. Das sind umfangreiche Untersuchungen, die ursprünglich von Paul Baltes und Karl Ulrich Mayer 1990 mit mehr als 500 Probanden auf den Weg gebracht und immer wieder um aktuelle Daten ergänzt wurden. Psychologische Faktoren, kognitive, aber auch sozio-ökonomische; Gesundheit, psychische Gesundheit, allgemeine Zufriedenheit, alles. Eine tolle Quelle! 2009 kam – initiiert von meinem Kollegen Ulman Lindenberger – BASE II hinzu. Und Sie können mir glauben: Das sind eine Menge sehr individueller Geschichten, die da zusammenkommen…
…die Sie in Ihren Analysen nach Mustern und Regelmäßigkeiten abklopfen.
In aller gebotenen Vorsicht, ja. Zunächst konstatieren wir nur Zusammenhänge. Das Ziel ist natürlich, sie in weiterer Forschung genauer zu untersuchen, um dann Aussagen über Ursachen und Wirkungen machen zu können.
Sie betreiben also Grundlagenforschung.
Darauf lege ich Wert! Wir sind kein Institut für angewandte Altersforschung. Generell interessieren uns Entscheidungsprozesse und ihre Entwicklungsverläufe im höheren Lebensalter. Die Frage etwa, in welcher Form sich physische, psychische oder intellektuelle Veränderungen auf Entscheidungsstrategien auswirken: Wie behilft sich beispielsweise einer, dessen Merkfähigkeit altersbedingt nachlässt, wenn er eine sehr komplexe Wahl zu treffen hat?
Er beschränkt sich auf wenige Faktoren, von denen er aufgrund seiner Erfahrung weiß, dass sie für seine Interessen und in der entsprechenden Situation wirklich wichtig sind. Ihr Kollege Gerd Gigerenzer hat solche lebensklugen Strategien untersucht und daraus eine adaptive „toolbox“ zusammengestellt – einen Werkzeugkasten aus Heuristiken, die in vielen Situationen schnelle, einfache, aber nicht minder kluge Lösungen ermöglichen…
Das stimmt. Gerd Gigerenzer und ich haben hier am Institut sehr lange und intensiv zusammengearbeitet. Allerdings lassen sich im Experiment auch Situationen konstruieren, in denen ein alterstypischer Abbau der kurzfristigen Merkfähigkeit, der Schnelligkeit oder ganz allgemein der fluiden Intelligenz sehr wohl negativ zu Buche schlägt. Wir haben das letztes Jahr in einer umfangreichen Studie gezeigt. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sollten aus einer Vielzahl von Urnen voller Lose durch Versuch und Irrtum diejenige herausfinden, die Ihnen die besten Chancen auf einen Gewinn bietet. Da kommen Sie mit Weisheit und allgemeinem Weltwissen, also mit kristalliner Intelligenz nur sehr bedingt weiter. Dabei sind solche Herausforderungen durchaus lebensnah, auch für ältere Menschen: Denken Sie an wichtige Anschaffungen, an die Wahl einer passenden Wohnung, den Vergleich von Versicherungen oder die Anlage von Erspartem. Wir warnen also vor einer allzu sorglosen Haltung: Och ja, was mit dem Alter verloren geht, das gleicht sich alles aus durch höhere Effizienz und Lebenserfahrung. Oft ja, leider nicht immer.
Bei Großeltern aber liegt ein gewisses Alter in der Natur der Sache. Da sind die Entscheidungsstrategien meist fertig ausformuliert und nicht mehr Gegenstand von Entwicklung.
Deshalb interessieren sie uns als eine spezielle Gruppe. Aber auch ihre Situation betrachten wir zunächst unter dem Aspekt von Optionen und begründeter Auswahl. Denn ob und wie sich Großmütter oder ein Großväter um ihre Enkel kümmern – das ist natürlich für viele in diesem Alter eine lebensbestimmende Entscheidung.
Wenn das so ist – sollte dann die Lebenssituation „Großeltern“ nicht auch auf Ähnlichkeiten in den Entscheidungsstrategien schließen lassen?
Vorsicht! Natürlich sind in unserer Stichprobe ältere Menschen, die sich sehr engagiert mit ihren Enkeln beschäftigen. Aber wir finden in dieser gewaltigen Zahl von Lebensumständen und -modellen auch Menschen, die sich in ganz anderer Weise um andere kümmern. Man kann ja beispielsweise auch ein Pflegekind oder ein „Patenkind“ haben. Hier im Berliner Kontext ist das keineswegs selten. Oder man kann sich um Asylbewerber kümmern, die nach Deutschland kommen und die Sprache lernen wollen. Oder man kocht den Kindern der alleinerziehenden Nachbarin ein Mittagessen und betreut sie bei den Hausaufgaben. Mit anderen Worten: Man kann auf vielerlei Art und Weise sich a) eine kognitive Herausforderung suchen und b) auch sozial eingebettet sein. Das müssen nicht notwendigerweise eigene Enkelkinder sein.
Also ist es der Kontakt zu anderen, der zählt?
Der spielt sicher eine Rolle. Aber wir sollten es uns nicht zu einfach machen. Denn aus der Vielfalt der Daten und Geschichten lässt sich kein allgemeingültiges Modell für Gesundheit im Alter herausdestillieren. Und zweitens liegt es meinen Kollegen und mir fern, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Wir bewegen uns bei vielen Phänomenen nun mal im Bereich statistischer Zusammenhänge. Wenn es gilt, Ursachen und Wirkungen zu benennen, sollten wir vorsichtig sein.
Wie lassen sich in so komplexen – und übrigens auch: so deutlich auf die Gegenwart bezogenen – Verflechtungen Wirkmechanismen herausarbeiten? Gar solche, die auf die Evolution des Menschen zurückgreifen…
Der Ausgangspunkt dieser Forschung war der evolutionstheoretisch begründete sogenannte Großmutter-Effekt. Er besagt, dass in aller Regel die Großmutter auf der mütterlichen Seite die meisten und wichtigsten großelterlichen Investitionen tätigt, in anderen Worten, sich in vielerlei Hinsicht um das oder die Enkelkinder kümmert. Diese Regularität lässt sich auch heute nachweisen. Es ist also die Mutter der Mutter, die sich in der Regel mehr als andere engagiert, Zeit aufwendet, Opfer bringt.
Nun haben sich die Zeiten geändert, seit Menschen sich als Jäger und Sammler um ihr Lagerfeuer scharten. Welche Bedeutung hat ein solches Konzept, wenn Familien an weit auseinanderliegenden Orten leben, Eltern sich scheiden lassen, neue Beziehungen entstehen und Kinder in einem bunt zusammengewürfelten Patchwork aufwachsen?
Genau das kritisieren auch Soziologen und Sozialwissenschaftler: In der evolutionstheoretischen Sichtweise kämen gesellschaftliche Umstände zu kurz, also zum Beispiel Rollenbilder und Erwartungen, die sich speziell an Großmütter richteten – dass die nämlich für die Enkel da sind und sich um ihre Töchter kümmern, die selber Mütter geworden sind, weil sich solche Arbeitsteilung etwa in der Geschichte der Industrialisierung bewährt hat. Nun muss man sich aber fragen, ob evolutionstheoretische und sozialwissenschaftliche Perspektiven notwendigerweise inkompatibel sind. Ich denke, sie sind es nicht zwangsläufig. Wir haben das in mehreren Publikationen ausführlich dargelegt: Die sozialen Rollen- und Normvorstellungen können sehr wohl Ausdruck von evolutionären Dynamiken sein. Unabhängig vom Großmutter-Effekt und anderen evolutionstheoretisch begründeten Effekten geht es auch um Fragen, die über Disziplinen hinweg bedeutsam sind: Was ist der Nutzen großelterlicher Investitionen für die Empfänger, also die Enkelkinder und die Eltern? Es geht auch darum: Was ist der psychologische und sonstige Nutzen für die Großeltern selbst?
Also doch eine Investition im klassisch ökonomischen Sinn?
Ich weiß nicht, ob Sie da nicht im Einzelfall das Maß an Bewusstheit überschätzen. Aber grundsätzlich ergeben die Zusammenhänge ein klares Bild: Sozialkontakte zu haben, helfen zu können, im Alter einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen – das alles hat im Mittel positive Konsequenzen für die Gesundheit. Damit auch für die Mortalität…
…na bitte: Man lebt länger.
Ja – aber immer noch ist die Frage offen, welches die Kausalmechanismen sind. Möglicherweise sind großelterliche Aktivitäten hilfreich im Kontext kardiovaskulärer Erkrankungen. Einfach, weil man mehr in Bewegung ist. Möglicherweise helfen sie, den kognitiven Abbau zu verlangsamen. Weil man nämlich planen, organisieren, sich auseinandersetzen muss. Vielleicht spielen auch hormonelle Veränderungen eine Rolle, wie zum Beispiel das Hormon Oxytocin, welches das soziale Miteinander beeinflusst – man kann sich da viele Mechanismen vorstellen. Allerdings hat das noch niemand untersucht. Daran wäre in Zukunft zu arbeiten.
Immerhin: Die Thesen sind formuliert, und plausibel sind sie obendrein. Auch wenn es bei Ihrer Arbeit um Grundlagenforschung geht – vielleicht mögen Sie mal Ihre Phantasie spielen lassen: Welche Erkenntnis ließe sich aus solchen Befunden für den Aufbau von öffentlichen Betreuungs- und Pflegesystemen destillieren? Ist es vielleicht ganz gut, wenn man ein Bild vom Alter entwirft, das auch soziale Verpflichtungen umfasst – sozusagen Märchen statt Mallorca?
Das sind Fragen von großer sozialer und politischer Relevanz, daher nochmals: Ich rate, mit den Befunden der Forschung vorsichtig umzugehen. Dafür habe ich zwei Gründe. Erstens haben wir Anlass zu der Vermutung, dass es einen Optimalwert von Engagement gibt, bei dem tatsächlich positive Effekte auf Gesundheit und Lebensfreude, auch auf die Erhaltung kognitiver Fähigkeiten zu erwarten sind. Wenn es darüber hinausgeht, wenn etwa Eltern dauerhaft krank werden oder sterben, wenn also Großeltern die Hauptlast der Verantwortung für ihre Enkel zu schultern haben, dann ist das nicht mehr Stimulanz, sondern Stress. Mit den bekannten negativen Konsequenzen auf die physische und psychische Gesundheit. Im Fall etwa von Depression der Eltern als Anlass für das Einspringen der Großeltern ist dieser Zusammenhang klar nachgewiesen. Aber niemand kann sagen, wann im Einzelfall der Punkt erreicht ist, an dem stimulierende Herausforderung in Überlastung mündet. Ich sage das, damit nicht der Eindruck entsteht, es sei alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Und der zweite Grund, Großeltern nicht als allzeit freudige, tatendurstige task force zur Betreuung von Enkeln, Nachbarskindern, allein lebenden Senioren oder Pflegebedürftigen einzuplanen?
Ist wiederum hervorgegangen aus unserer Forschungsarbeit am Max-Planck-Institut. Sie kennen den Begriff des „Nudging“, der ja gerade groß in Mode ist?
Das mehr oder minder sanfte Stupsen hin zu einem Verhalten, das – zumindest dem Anspruch nach – zum Besten des Einzelnen oder der Gemeinschaft ist.
Eine an sich brillante Idee. Denken Sie etwa an die Organspende, zu der man sich bisher ausdrücklich bereit erklären musste. Mit dem Resultat, dass ein bedrohlicher Mangel an Spenderherzen oder -nieren herrscht und nicht wenige Menschen leider vergeblich auf das lebensrettende Organ warten. Nudging schlägt nun vor, die Entscheidungsarchitektur einfach umzukehren: Aktiv werden muss demnach nicht mehr, wer zur Organspende bereit ist, sondern der, der sich dagegen ausspricht. Sehr klug – aber bei genauer Betrachtung eben doch eine Art der Bevormundung. Das Gegenkonzept wäre „Boosting“, also die deutliche Verbesserung von Entscheidungskompetenz. Ich habe die beiden Interventionsformen gerade in einem Papier zur Debatte gestellt. Und muss sagen: Es gibt Situationen, in denen ich dem Boosting eindeutig den Vorrang gebe. Vielleicht, weil ich ein optimistischeres Bild von der Entscheidungsfähigkeit der Menschen habe und deshalb finde: Jeder soll selbst entscheiden, was gut für ihn ist – also auch, wie oft und wie lange er mit den Enkelkindern auf den Spielplatz gehen sollte oder meinetwegen nach Mallorca an den Strand.
Interview: Martin Tschechne