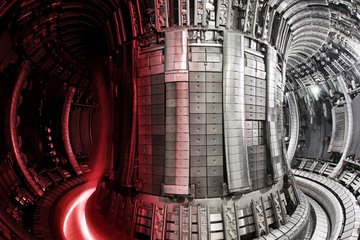Strom aus heißer Luft
Selbst der effizienteste Motor erzeugt mehr Wärme als Antrieb. Doch einen Teil dieser ungenutzten Energie könnten thermoelektrische Generatoren in Strom verwandeln. Dieses Ziel verfolgen Juri Grin und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe in Dresden. Sie suchen nach Materialien, die sich dafür besonders gut eignen.
Text: Christian Meier

Die Begriffe, die Juri Grin benutzt, klingen ungewohnt. Er spricht davon, Abwärme zu recyceln oder zu ernten. Müll wiederverwerten, ja, das ist gang und gäbe. Aber Abwärme-Recycling? Äpfel ernten, o. k. Aber was ist eine Abwärme-Ernte?
Nach Ansicht von Juri Grin etwas absolut Notwendiges. „Wir Menschen erlauben uns einen sehr großen Luxus“, sagt der Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe in Dresden. „Nur etwa ein Drittel der in Kohle, Gas oder Öl enthaltenen Primärenergie wandeln wir in nutzbare Energie wie elektrischen Strom oder Wärme zum Heizen um.“ Der Rest entweiche als Abwärme ungenutzt in die Umwelt. „Schon wegen des Klimawandels können wir uns das nicht mehr leisten“, sagt Juri Grin.
Um das zu ändern, beschäftigen sich der Chemiker und einige seiner Mitarbeiter mit einer bestimmten Möglichkeit, Abwärme zu recyceln. Die Grundidee: Thermoelektrische Materialien, oder kurz Thermoelektrika, sollen zumindest einen Teil der bislang ungenutzten Energie in Elektrizität umwandeln. Für diese Aufgabe kommen verschiedene chemische Verbindungen in Frage. Zwei spezielle Klassen dieser Stoffe untersucht das Forscherteam um Juri Grin am Dresdner Max-Planck-Institut.
Ein Temperaturunterschied als Spannungsquelle
Bekannt sind Materialien, die Wärme in Strom verwandeln, schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Eher per Zufall hat sie der Physiker Thomas Johann Seebeck entdeckt. Auch technische Anwendungen finden Thermoelektrika, die aus elektrischen Leitern oder Halbleitern bestehen, bereits seit Längerem: Jedes Thermoelement misst die Temperatur mithilfe des thermoelektrischen Effektes. Und auch Strom wird mit den Stoffen erzeugt, nämlich dort, wo andere Stromquellen nicht zur Verfügung stehen oder wo es auf verschleißfreien und damit wartungsarmen Einsatz ankommt – etwa in Weltraumsonden, die ferne Planeten und Monde umrunden.

Im Innern der Flugkörper zerfällt eine radioaktive Substanz in einem Reaktor und erzeugt dabei eine Temperatur von mehreren hundert Grad Celsius. Draußen im All liegt die Temperatur unter minus 270 Grad. Die sich ergebende Temperaturdifferenz von mehr als 1000 Grad bietet ideale Bedingungen, um Strom mit einem thermoelektrischen Material zu erzeugen, das rings um den radioaktiven Kern in den Mantel der Sonde eingearbeitet ist. Denn genau ein solches Temperaturgefälle ist der Nährboden für die thermoelektrische Energieumwandlung.
Der Temperaturunterschied bewirkt, dass die Ladungsträger an heißen Stellen des Stoffs eine höhere Energie besitzen als an den kalten. Dadurch baut sich eine elektrische Spannung auf, die mit der Temperaturdifferenz wächst.
Dieses Prinzip der Stromerzeugung soll in Zukunft nicht mehr auf so extreme Anwendungen wie die Raumfahrt beschränkt bleiben. Denn auch Autos und Kraftwerke produzieren reichlich Wärme, die bislang ungenutzt verpufft. Ein deutscher Autohersteller hat daher im Jahr 2008 einen thermoelektrischen Generator in einen Testwagen eingebaut. Er wandelt einen Teil der Abgaswärme in Strom für die Bordelektronik um und spart so Treibstoff, nach Angaben des Unternehmens immerhin fünf bis acht Prozent.
Das große Potenzial solcher thermoelektrischer Generatoren wird in einer einfachen Rechnung klar: Wenn nur zehn Prozent der deutschen Pkw-Flotte, also rund fünf Millionen Autos, mit einem thermoelektrischen Generator ausgerüstet würden, der ein Kilowatt elektrische Leistung erzeugt, und wenn jeder dieser Generatoren 200 Stunden pro Jahr aktiv wäre, ließen sich 100 Millionen Liter Treibstoff sparen.
Dieses vielversprechende Szenario krankt nur daran, dass es bislang keine thermoelektrischen Generatoren mit ausreichender Leistung gibt. Denn derzeit wandeln Thermoelektrika Wärme nicht besonders effizient in Elektrizität um. Forscher in aller Welt wollen das ändern, unter ihnen auch Juri Grin und seine Mitarbeiter. Sie entwickeln thermoelektrische Materialien, die sich vor allem durch eine möglichst hohe Gütezahl, abgekürzt ZT, auszeichnen.
Kann ein Stoff gut Strom und schlecht Wärme leiten?
Die Gütezahl gibt ein numerisches Maß, wie effektiv ein Material thermische in elektrische Energie umwandelt, und hängt von drei physikalischen Größen ab: Sie steigt mit dem Seebeck-Koeffizienten. Benannt nach dem Entdecker der Thermoelektrizität, gibt diese Materialeigenschaft die Spannung an, die sich bei einem Grad Temperaturunterschied zwischen den Enden eines Thermoelektrikums aufbaut. Auch eine möglichst gute elektrische Leitfähigkeit erhöht die Gütezahl. Sie bestimmt, wie gut die Ladungsträger durch das Material fließen. Von der thermischen Leitfähigkeit hängt schließlich ab, wie schnell sich die Temperaturdifferenz ausgleicht, die der Spannung zugrundeliegt. Um eine hohe Gütezahl zu erreichen, sollte die thermische Leitfähigkeit eines Materials daher möglichst gering sein.

Es gilt also Materialien zu finden oder zu entwickeln, deren elektrische Leitfähigkeit hoch, deren Wärmeleitfähigkeit jedoch niedrig ist. Und genau da liegt das Problem. Denn in gewöhnlichen Metallen und Halbleitern sind die thermische Leitfähigkeit und die elektrische Leitfähigkeit gekoppelt. Beide Eigenschaften werden schließlich von der Zahl der freien Ladungsträger bestimmt – sie transportieren Strom und tragen auch maßgeblich zur Wärmeleitung bei.
So lässt sich die elektrische Leitfähigkeit ändern, indem man etwa Fremdatome in das Kristallgitter eines Thermoelektrikums einbaut, die mehr oder weniger Elektronen als die Hauptkomponenten zur Menge der leitenden Elektronen beisteuern. Doch was die Gütezahl durch die steigende elektrische Leitfähigkeit gewinnt, wird durch die Erhöhung der thermischen Leitfähigkeit wieder zunichte gemacht. Bis in die 1990er-Jahre herrschte daher die Meinung vor, dass dieses scheinbar unlösbare Dilemma die Entwicklung effizienter Thermoelektrika verhindert. Das Thema erschien nicht mehr interessant.
„Dann aber wurden Materialien entdeckt, bei denen die elektrische und thermische Leitfähigkeit teilweise entkoppelt sind“, sagt Juri Grin. Da sich nun ein Ausweg aus dem Leitfähigkeits-Dilemma öffnete und zudem weitere Materialeigenschaften optimiert wurden, schienen effiziente thermoelektrische Generatoren auf einmal möglich. Das habe die Forschung befeuert, meint der Wissenschaftler. So fördert inzwischen auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft diese Forschung im Schwerpunktprogramm „Nanostrukturierte Thermoelektrika“.
Kombinierte Bindungen lösen das Dilemma
Juri Grin und seine Mitarbeiter beginnen die Suche nach effizienten thermoelektrischen Materialien mit einer grundlegenden Frage: „Wir möchten herausfinden, wie die Art der chemischen Bindung in einem Material dessen physikalische Eigenschaften beeinflusst“, erklärt Grin. Die Forscher untersuchen also, wie die elektrische und thermische Leitfähigkeit davon abhängen, ob die Bindungen ionischer Natur sind, also auf elektrostatischen Kräften zwischen Ionen beruhen, oder ob benachbarte Atome durch gemeinsame Elektronenpaare miteinander verknüpft sind und kovalente Bindungen ausbilden. Dabei haben sie festgestellt, dass sich in raffinierten Kombinationen ionischer und kovalenter Bindungen die beiden Eigenschaften bis zu einem gewissen Grad entkoppeln lassen. Diese Zusammenhänge zu verstehen hilft den Wissenschaftlern, gezielt Thermoelektrika mit möglichst hoher Gütezahl zu synthetisieren.

Zwei Materialklassen halten die Dresdner Forscher dabei für besonders vielversprechend: gefüllte Skutterudite und intermetallische Clathrate. Die beiden Substanzklassen unterscheiden sich in den chemischen Elementen, aus denen sie sich zusammensetzen, und in ihrer Kristallstruktur. Skutterudite bestehen aus Phosphor, Arsen oder Antimon sowie aus ausgewählten Elementen der Eisen- und Kobaltgruppe oder der Gruppe der Platinmetalle. Clathrate enthalten dagegen Elemente der vierzehnten Gruppe des Periodensystems, nämlich Germanium und Silizium sowie der dreizehnten Gruppe wie etwa Aluminium, oder aber der Übergangsmetalle wie Nickel. Als Thermoelektrika sind sowohl die Skutterudite als auch die Clathrate dann besonders interessant, wenn sie zusätzliche Metallatome oder -ionen enthalten. Diese sitzen in Hohlräumen, die in den Kristallstrukturen der Materialien vorhanden sind.
„Wir streben ein ganzheitliches Verständnis dieser Verbindungen an“, erklärt Juri Grin. Denn eine hohe Gütezahl reiche nicht, um ein Material für Generatoren zum Beispiel in Autos zu empfehlen. „Wichtig ist auch, dass das Material zwischen 300 und 600 Grad Celsius am effizientesten arbeitet“, ergänzt sein Mitarbeiter Michael Baitinger. Denn in diesem Bereich liegt die Temperatur der Autoabgase. „Das Material muss darüber hinaus bei solchen Temperaturen lange Zeit stabil bleiben“, sagt der Forscher. Und es sollte sich auch nicht stark ausdehnen, wenn es heiß wird. Andernfalls lässt es sich kaum dauerhaft in einem Generator einbauen.
Ein Material, das diesen Anforderungskatalog erfüllt, lasse sich nur mit einem tiefgehenden Verständnis der Chemie und Physik identifizieren. „Neben dem Einfluss der chemischen Bindung müssen wir auch verstehen, wie die physikalischen Eigenschaften von der Art des Gefüges abhängen“, sagt Grin. Das Gefüge beschreibt die Form, Größe und chemische Zusammensetzung der mikroskopisch kleinen Körner, aus denen sich ein Festkörper zusammensetzt.
Atome, die in ihren Käfigen schwingen
Zunächst aber lautet die wichtigste Frage: Wie lassen sich elektrische und thermische Leitfähigkeit möglichst unabhängig voneinander beeinflussen? Immerhin liefert die Natur einen Ansatzpunkt für eine Antwort. Denn Wärme wird in einem Material nicht nur von den freien Elektronen transportiert, die auch beim Strom fließen. Diese Komponente der Wärmeleitfähigkeit steigt notgedrungen mit der elektrischen Leitfähigkeit an. Doch Wärme wird auch von Schallwellen weitergeleitet, oder in der Sprache der Wissenschaftler: von Phononen, die sich durch das Material fortpflanzen.

Die Phononen zu absorbieren erlaubt es, die thermische Leitfähigkeit zu senken, ohne die elektrische Leitfähigkeit zu beeinträchtigen. „Wir haben herausgefunden, dass dies in Materialien möglich ist, in denen sowohl kovalente als auch ionische Bindungen vorkommen“, erklärt Grin. So wie bei den intermetallischen Clathraten und gefüllten Skutteruditen.
In den Clathraten etwa verknüpfen kovalente Bindungen die meisten Atome einer oder mehrerer Sorten von Elementen zu einem Gitter: Fußballähnliche Polyeder, die aus Fünf- oder Sechsecken bestehen, stapeln sich darin zu einer filigranen Struktur. Die Hohlräume des Gitters beherbergen Ionen eines anderen Elements. Wie in einem Käfig sitzen die geladenen Teilchen, festgehalten durch das elektrische Feld des Clathrat-Gitters. Sie sind also ionisch gebunden.
Das Gitter der kovalent gebundenen Atome und die Ionen in den Käfigen übernehmen jeweils unterschiedliche Aufgaben. Während die Wände den elektrischen Strom leiten, absorbiert das Ion im Käfig Schwingungen oder Phononen, die durch das Kristallgitter laufen. Trifft nämlich ein Phonon auf den Käfig, wird das Ion aus seiner stabilsten Lage in der Mitte des Käfigs ausgelenkt. Durch diesen Anstoß beginnt es in seinem Käfig zu schwingen wie eine Kugel in einer Kinderrassel. Bildhaft kann man sich vorstellen, dass das schwingende Ion die Energie des Phonons aufnimmt, wie eine schwere Metallkugel unter einem Wolkenkratzer bei einem Erdbeben die Schwingungen des Gebäudes absorbiert.
Physikalisch etwas genauer gefasst, regt Wärme das Gitter der kovalent gebundenen Atome und die eingeschlossenen Ionen zu Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen an. Die beiden Schwingungen dämpfen sich gegenseitig, sodass die Wärme auf diesem Weg nicht gut geleitet wird. Dieser Mechanismus lässt sich verstärken, ohne dadurch die elektrische Leitfähigkeit zu beeinträchtigen.
Genau das ist Juri Grin und seinen Mitarbeitern gelungen. Sie haben sowohl Clathrate als auch Skutterudite unterschiedlicher Zusammensetzung synthetisiert und auf ihre Tauglichkeit als Thermoelektrikum getestet. Dabei stochern sie nicht wahllos in der schier endlosen Menge möglicher chemischer Zusammensetzungen herum. Vielmehr berechnen die Forscher mithilfe quantenchemischer Modelle zunächst, welche chemischen Bindungsverhältnisse in einer Verbindung herrschen. „In den Rechnungen variieren wir die chemische Zusammensetzung, die Anordnung der Atome und die Kristallstruktur“, erklärt Juri Grin.
Ein Ansatzpunkt für effiziente Thermoelektrika
Die Rechnungen offenbaren, wo im Kristall welche Bindungsart – kovalent oder ionisch – überwiegt. Verbindungen, die demnach in einem kovalent verknüpften Gitter kristallisieren und deren Hohlräume Ionen umschließen, gelten als vielversprechende Kandidaten. Diese versuchen die Chemiker nun zu synthetisieren und analysieren anschließend ihre genaue Zusammensetzung und Kristallstruktur. Gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Abteilung „Festkörperpyhsik“ von Frank Steglich bestimmen sie zudem die physikalischen Eigenschaften, von denen die Gütezahl abhängt.

Auf diese Weise haben die Dresdner Forscher im Laufe der Zeit Clathrate identifiziert und hergestellt, deren Gütezahlen mit dem in der Praxis bereits eingesetzten Wismuttellurid vergleichbar sind. „Wir sehen zudem die Möglichkeit, mit unserem Ansatz künftig noch effizientere Thermoelektrika zu entwickeln“, sagt Juri Grin.
Unterdessen gehen die Dresdner Forscher ein weiteres Problem an, das eine technische Verwendung der Clathrate und Skutterudite verhindern könnte – ihre Herstellung. Für Laborzwecke synthetisieren die Chemiker diese Substanzen meistens, indem sie die Ausgangsstoffe zusammenschmelzen. Doch diese Methode liefert nur unter großem Aufwand den gewünschten Stoff, und das nur in relativ kleinen Mengen. Meist ist das Produkt nicht einheitlich zusammengesetzt, weil in der Schmelze alle möglichen Verbindungen entstehen. Ein Stoff muss daher tage-, wochen- und manchmal sogar monatelang mit Hitze nachbehandelt werden. Für die Industrie erweist sich das Verfahren somit als völlig unbrauchbar.
„Wir wollten daher Präparationsmethoden weiterentwickeln, bei denen die Ausgangsstoffe in fester Form miteinander reagieren“, erklärt Bodo Böhme, der sich vor allem mit der Synthese beschäftigt. Sie erlauben Chemikern, neue Zusammensetzungen thermoelektrischer Materialien zu erzeugen. Sie müssen die Ausgangsstoffe nur dazu bringen, sich auf ein chemisches Techtelmechtel einzulassen, wenn die Substanzen Körnchen an Körnchen nebeneinander liegen und nicht gerade dahinschmelzen.
In verschiedenen Ansätzen sammelten die Dresdner Forscher zunächst Hinweise, dass sich auch feste Stoffe für eine Reaktion erweichen lassen – etwa als sie die Methode des Spark-Plasmasinterns, kurz SPS, testeten. Mit ihr verdichtet man in der Industrie bislang Metall- oder Keramikpulver und verbackt sie zu einer bestimmten Form. Ein kräftig zusammengepresstes Pulver wird dabei mit nur wenige Millisekunden langen, aber sehr starken Gleichstrom-Stößen bearbeitet, sodass sich die Pulverkörner leicht verformen und verdichten.
Ein chemisches Hilfsmittel verbessert die Kontrolle
„Wir haben entdeckt, dass man mit diesem Verfahren auch Chemie machen kann“, sagt Grin. Unter den Bedingungen der SPS-Methode können Atome nämlich zwischen den Körnchen hin- und herwandern und Reaktionen eingehen. Doch für eine industrielle Großproduktion von Thermoelektrika eignet sich dieses Verfahren auch nicht, weil es wie die Schmelzmethode nur einzelne Proben liefert, deren Eigenschaften sich zudem ein wenig voneinander unterscheiden können. Die Industrie aber hätte gerne ein Verfahren, welches kontinuierlich arbeitet, das fertige Material also ausspuckt wie ein Förderband Kies.
Schon während ihrer Experimente mit dem Plasmasintern erprobten die Dresdner Chemiker jedoch auch andere Mittel als Druck und Stromstöße, um die festen Ausgangsstoffe zur Reaktion zu drängen. Als Methode der Wahl erwies sich schließlich zumindest für die Herstellung der Clathrate der Einsatz eines Oxidationsmittels, genauer gesagt von Chlorwasserstoff-Gas. Das Gas, das in Wasser gelöst Salzsäure ergibt, leiten die Forscher in einen Reaktor, in dem sich ein Pulver der Ausgangssubstanz befindet. Während das Oxidationsmittel nun über die Ausgangsverbindung mit allen beteiligten Elementen streicht, stößt es die chemische Partnerwahl an.
„Dieses Verfahren öffnet ein neues Kapitel in der Präparation intermetallischer Festkörper wie etwa der Clathrate“, sagt Juri Grin. Es erlaube Chemikern, viel genauer als bislang die Zusammensetzung thermoelektrischer Materialien zu beeinflussen. Welche Atome darin eingebaut sind, entscheidet nämlich über die Anzahl der Elektronen, die zur Leitfähigkeit beitragen. Die Methode lässt sich zudem auch in großtechnischem Maßstab umsetzen.
Dank ihres ganzheitlichen Ansatzes gelingt es den Forschern um Juri Grin also, die Effizienz der thermoelektrischen Materialien zu erhöhen und sie gleichzeitig für die industrielle Produktion und in der Anwendung handhabbar zu machen. Für diese Zwecke arbeiten sie mit den Fraunhofer Instituten für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) sowie für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) zusammen.
In dieser Kooperation, die der Freistaat Sachsen unterstützt, suchen die Max-Planck-Forscher nach den geeigneten thermoelektrischen Materialien und Methoden, sie herzustellen. Aus den pulverförmigen Stoffen, die sie dabei gewinnen, formen die Wissenschaftler des IFAM Werkstücke, die sich in Generatoren einbauen lassen. Die Generatoren dazu konstruieren Mitarbeiter des IKTS. So kommen Juri Grin und seine Kollegen allmählich ihrem Ziel näher, mit thermoelektrischen Generatoren Abwärme zu recyceln – und vielleicht klingt dann in einigen Jahren dieser Ausdruck auch nicht mehr so ungewohnt.
So funktioniert ein thermoelektrischer Generator
Der Grundbaustein eines thermoelektrischen Generators – ein thermoelektrisches Modul – erinnert an den griechischen Buchstaben „Pi“, besteht also aus zwei Schenkeln, die elektrisch verbunden sind. Einer der Schenkel ist ein sogenannter n-Halbleiter (das n steht für negativ), der andere ein p-Halbleiter (das p steht für positiv). Während in n-Halbleitern (negativ geladene) Elektronen den Stromfluss ermöglichen, dienen dazu in p-Halbleitern positiv geladene Ladungsträger, sogenannte Löcher.
Das Modul ist oben, also auf der Seite des Balkens, heiß, und unten, also an den Enden der Schenkel, kalt. Weil die Elektronen und Löcher am jeweils heißen Ende des Schenkels höhere Bewegungsenergie als am kalten haben, gelangen in einer gewissen Zeit mehr Ladungsträger vom heißen zum kalten Ende als in umgekehrter Richtung. Am kalten Ende des n-Schenkels sammelt sich also negative Ladung, an dem des p-Schenkels positive. Zwischen den Schenkeln herrscht somit eine elektrische Spannung, die sich technisch nutzen lässt. Ein solches Modul erzeugt allerdings zu wenig Strom für die meisten technischen Anwendungen, deshalb werden viele davon hintereinandergeschaltet, wie Batterien in einer Taschenlampe. So entsteht ein thermoelektrischer Generator, der technisch nutzbare Spannungen erzeugt.