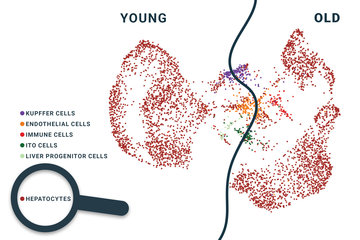Musterkristalle in der Muschel
Die große Steckmuschel nutzt für das Wachstum ihrer Kalzitschale physikalische Gesetze, die aus der Optimierung von Stählen bekannt sind
Muscheln sind wahre Meister der Biomineralisation. Nicht nur, dass sie aus einfachen Substanzen besonders harte und feste Verbundwerkstoffe für ihre Schalen bilden. Das Material entsteht auch auf vorbildhafte Weise. Das hat ein deutsch-französisches Team um Forscher des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm herausgefunden, als sie die Schale der großen Steckmuschel Pinna nobilis untersuchten und dabei erstmals ein genaues Bild des Kristallwachstums erhielten. Demnach entwickeln sich die Kalzit-Kristalle in der äußeren prismatischen Schicht der Schale genauso, wie es auch bei Körnern in Metallen und Legierungen beobachtet und durch Theorien beschrieben wird. Dabei werden einige große Kristallite immer größer und verdrängen allmählich kleinere Kristallkörner. Mit dieser Erkenntnis wird klar, dass die Muschel als lebender Organismus auf ähnliche Prozesse zurückgreift, wie sie auch zur Optimierung von Stählen verwendet werden. Denn sie muss nur die thermodynamischen Rahmenbedingungen wie die Temperatur und die Konzentration der Ausgangsstoffe für das Wachstum der Kalzit-Kristalle vorgeben, den Prozess darüber hinaus aber nicht beeinflussen.

Die Evolution hat eine Vielzahl biologischer Materialien hervorgebracht – eine Schatztruhe für die Wissenschaft. Diese natürlichen Materialen besitzen oft außergewöhnliche mechanische Eigenschaften und sind optimal an ihre Aufgaben angepasst. Dabei verwenden Lebewesen für die Materialien, die ihnen Halt und Schutz bieten oder als Jagdwaffen dienen, nur eine begrenzte Zahl chemischer Elemente. Doch was ihnen an chemischer Vielfalt fehlt, machen sie durch raffinierte Strukturen wett. Muschelschalen sind dafür hervorragende Beispiele: Sie bestehen hauptsächlich aus hartem, aber sprödem Kalzit, nichts anderem also als Calciumcarbonat, das als Kalk die Waschmaschine lahmlegen kann. Doch die Muschel verklebt die Kalzit-Kristalle mit einem Protein. So bildet sie nicht nur das schillernde Perlmutt, mit dem sie die Innenseite ihrer Schale auskleidet, sondern auch die Prismenschicht, die den Großteil der Schale ausmacht und deutlich stabiler ist als reiner Kalzit gleicher Dicke. Wissenschaftler um Igor Zlotnikov und Peter Fratzl vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung haben nun Details aufgedeckt, wie die Kalzit-Kristalle in der Prismenschicht wachsen.
Eine Kalzit-Säule wird zum versteinerten Film der wachsenden Kristalle
Das deutsch-französische Forscherteam hat nun die Prismenschicht von Pinna nobilis mithilfe der hochaufgelösten Mikrotomographie analysiert: Mit der besonders intensiven Röntgen-Strahlung der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) fertigten die Wissenschaftler in einer Art Computertomografie, wie man sie aus der Medizin kennt, ein mikroskopisches 3D-Profil der Kalzit-Schicht an. So erkannten die Wissenschaftler in der Prismenschicht Strukturdetails von der Größe weniger Mikrometer. Demnach ähnelt die Anordnung der meist sechseckigen Kristallite von oben betrachtet einer verzerrten Honigwabe. Je tiefer man in die Schicht blickt, desto größer wird der durchschnittliche Durchmesser der Prismen – die Mikrostruktur vergröbert sich.

Dabei zeichnen die Kalzit-Säulen das Wachstum der Kristallite wie in einer Art versteinertem Film auf: Da die Kristallite nur an ihrem unteren Ende wachsen, bildet das obere Ende ab, wie groß die Kristallkörner zu Beginn des Wachstums waren und wie sie sich anfangs verteilten. Durch die Prismenschicht lässt sich dann verfolgen, wie sich deren Mikrostruktur, also die Größe und Verteilung der Kalzit-Kristalle während des Wachstums ändert. „In der Prismenschicht können wir die Bildung und Entwicklung der einzelnen Kristallkörner genau studieren“, sagt Igor Zlotnikov, der die Studie leitete. „Und sie liefert uns ein Musterbeispiel für das Kornwachstum von Kristallen.“ Denn die Kalzit-Kristalle wachsen in der Schale der Muschel genauso, wie es die Theorie aus den Materialphysik-Lehrbüchern vorhersagt.
Ihre Beobachtungen überraschten die Wissenschaftler in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ließ sich das Wachstum von Kristallkörnern bislang nicht im Detail verfolgen. Daher simulierten Materialwissenschaftler den Vorgang bisher vor allem am Computer, um sich ein Bild davon zu machen. Zum anderen war nicht zu erwarten, dass Kalzit-Kristalle auch unter der Ägide der Muschel genauso wachsen, wie in Stählen oder Aluminiumlegierungen. Vielmehr war zu erwarten, dass die Muschel das Wachstum stärker steuert und daher auch die Kristallite anders aussehen als unter anorganischen Bedingungen.
Die physikalischen Bedingungen beschränken die Vielfalt biologischer Strukturen
„Die Bildung der Schale kann somit durch thermodynamische Modelle beschrieben werden“, sagt Igor Zlotnikov. Diese Modelle berücksichtigen alleine die chemischen und physikalischen Randbedingungen für das Kristallwachstum und würden den Prozess nicht richtig erfassen, wenn die Muschel die Größe und Verteilung der Kristallite beeinflusste. „Die Muschel beeinflusst den Wachstumsprozess offenbar aber nur insofern, als sie die thermodynamischen Randbedingungen, also die Temperatur, den pH-Wert und die Konzentration der Ausgangsstoffe festlegt“, erklärt Zlotnikov.
„Diese Beobachtung deckt sich genau damit, was wir von der Entwicklung der Mikrostruktur in anorganischen polykristallinen Systemen erwarten“, so Igor Zlotnikov. „Unsere Resultate zeigen, wie Organismen die physikalischen Gegebenheiten nutzen, um komplexe Formen zu schaffen. Und sie helfen uns zu verstehen, welche Umgebungsbedingungen die Formen von Mineralien biologischen Ursprungs bestimmen.“ Wie Organismen die Struktur von Biomineralien über die thermodynamischen Randbedingungen steuern und welchen Spielraum sie dabei nutzen, um vielfältige Materialien zu erzeugen, wollen die Forscher um Igor Zlotnikov unter Ausnutzung der natürlichen Diversität nun weiter ausloten. Zu diesem Zweck werden sie in ihren nächsten Arbeiten untersuchen, mithilfe welcher Prinzipien andere Muschelarten die Mikrostruktur ihrer Schalen steuern.
Im Gegensatz zu den meisten Untersuchungen, die Forscher aus der Abteilung von Peter Fratzl an Biomaterialien vornehmen, dienen die Erkenntnisse aus der aktuellen Studie weniger dazu, neuartige, technische Werkstoffe zu entwickeln. In diesem Fall war es gerade umgekehrt. Die Theorien zum Kornwachstum wurden in der Werkstoffforschung aufgestellt und tragen etwa dazu bei, die Eigenschaften von Stählen zu verfeinern. Die Erkenntnisse aus der Technik haben den Potsdamer Max-Planck-Forschern nun geholfen, einen biologischen Vorgang besser zu verstehen. Denn die Muschel nutzt Prinzipien aus der Physik für ihre eigenen Zwecke, nämlich um die Struktur ihrer Schale zu erzeugen.
DU/PH