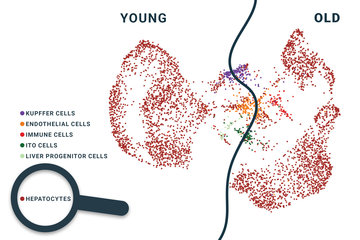Leben mit Licht und Farbe
Ein Gespräch über Biochemie
Für die Serie "Lives in Chemistry" hat der Wissenschaftshistoriker und Heisenberg Fellow an der Humboldt Universität Mathias Grote mit Dieter Oesterhelt über sein Leben und seine Forschung gesprochen. Mit Zustimmung des Verlags veröffentlichen wir hier einen Auszug aus der Interview-Biografie vorab. Das Buch erscheint im Frühjahr 2022.

Mathias Grote: Die Entdeckung des Bakteriorhodopsins, jenes Moleküls, das Ihre Karriere wesentlich bestimmte, fand in San Francisco statt. 1970 brachten Sie dieses gänzlich neue Forschungsthema dann als Nachwuchswissenschaftler mit zurück nach München – Sie waren der Einzige in Deutschland, der zu diesem Thema arbeitete. Wie gingen Sie mit der Unsicherheit um, dass niemand sagen konnte, ob dieser Vorstoß ins Unbekannte zu irgendetwas führen würde?
Dieter Oesterhelt: In der Tat stieß ich bei den Kollegen auf Desinteresse bis vollkommenen Unglauben. Mir war aber klar, dass hinter dem Farbwechsel dieses Moleküls von purpur zu gelb, den ich im Reagenzglas beobachtet hatte, etwas Wichtiges stecken musste und von dieser Überzeugung bin ich nie abgerückt. Auch Feodor Lynen, mein Doktorvater, mein damaliger Chef an der Biochemie der Universität München und Nobelpreisträger zeigte sich nicht sonderlich begeistert von diesem neuen Thema. Er ließ mich aber machen, denn er hatte die Einstellung, dass Habilitanden sich ein eigenes Thema suchen und selbstständig bearbeiten sollten. Als ich ihm einmal meine Theorie der biologischen Funktion des neuen Moleküls an der Tafel skizzierte, kam von ihm der schöne Satz: „Herr Oesterhelt, ich glaube das nicht, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie recht haben.“ Die Situation änderte sich rasch nach 1972, als ich erste Daten zur Funktion dieses Moleküls hatte und zeigen konnte, dass es eine Pumpe war, welche für die Zelle Lichtenergie in chemische Energie umwandelt und damit eine neue Form der Photosynthese bewerkstelligt. Ab diesem Punkt gab es lebhaftes Interesse von verschiedenen Seiten.
Welche verschiedenen Planungen und Vorhaben gab es, aus der Entdeckung dieser „molekularen Pumpe“ Technologien zu entwickeln und was wurde daraus?
Es lassen sich im Wesentlichen vier Versuche unterscheiden: Bereits in den siebziger Jahren, unter dem Eindruck der Ölkrisen, dachte man daran, mittels dieser molekularen Pumpe Lichtenergie mittels einer Art künstlichen Photosynthese zu nutzen – diese Ideen kamen nie aus dem Stadium der Planung auf einem Blatt Papier hinaus. Mitte der siebziger Jahre haben wir die Möglichkeit publiziert, die Pumpe zur Entsalzung von Seewasser einzusetzen. Auch daraus wurde nichts. Dann wurde in den 1980er und 1990er Jahren versucht, die Substanz aufgrund ihrer Lichtaktivität als optischen Datenspeicher zu nutzen, der mit einem Laser beschrieben und ausgelesen werden konnte – in etwa vergleichbar mit der Compact Disc (CD), die älteren Semester noch kennen. Solche Projekte gab es weltweit, interessanterweise auch in der Sowjetunion. Wir betrieben das sehr intensiv gemeinsam mit dem Physiker Norbert Hampp von der Universität München, später Marburg. Das Potenzial dieser Anwendungen war faszinierend: Hampp zeigte mir damals zum ersten Mal, wie man ein ferngesteuertes Auto mit Bakteriorhodopsin dirigieren kann! Es waren ungeheure Effekte dabei, beispielsweise auch im Bereich Materialprüfung: Durch Interferometrie Risse etwa in einer Schweißnaht zu entdecken, so etwas war mit diesem Molekül möglich! Die Technologie funktionierte – nur interessierte sich die Wirtschaft ab einem gewissen Punkt nicht mehr dafür. Und dann kam nach 2000 die Idee auf, die Bakteriorhodopsin verwandte lichtsensitive Pumpe Halorhodopsin sowie das von Peter Hegemann entdeckte Kanalrhodopsin gentechnologisch in Gewebe einzuschleusen. Karl Deisseroth und seine Kollegen haben dies erfolgreich auf Neuronen angewendet und damit die Geburtsstunde eines neuen Forschungsfeldes, der Optogenetik, eingeleitet: Nervenzellen mit Licht zu aktivieren und mit Licht anderer Wellenlänge wieder auszuschalten. Diese Zeitspanne von fast vierzig Jahren verdeutlicht, welchen langen Atem es braucht, um aus wissenschaftlichen Erkenntnissen Technologien zu entwickeln und dass auch funktionierende Technologien aus vielerlei Gründen keinen Markt finden können.
Beschreiben Sie den Weg von Ihrer Forschung an dem erwähnten Halorhodopsin bis zu den ersten optogenetischen Experimenten. Welche Schritte waren dafür wichtig?
Diese Entwicklung begann in unserer Abteilung mit der Doktorarbeit von Peter Hegemann, der sich in den frühen achtziger Jahren zum Ziel gesetzt hatte, das Halorhodopsin zu isolieren, das heißt, es aus den Zellen zu extrahieren und zu reinigen, so dass man es mit Methoden der Chemie und Physik genauer charakterisieren konnte. Halorhodopsin ist ähnlich dem Bakteriorhodopsin eine molekulare Pumpe, allerdings nicht für Wasserstoff-, sondern für Chloridionen. Peter Hegemann war unglaublich zäh und bekam sehr viel heraus, wofür er auch die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft erhielt. Er ging dann als Postdoc in die USA, und zwar mit einem Versprechen meinerseits im Gepäck, danach eine Fünfjahresstelle als Leiter einer eigenen Gruppe in meiner Abteilung am MPI für Biochemie zu erhalten. In den USA bei Ken Foster nahm er die Suche nach vergleichbaren Proteinen in Algen auf und stellte fest, dass diese eher wie molekulare Kanäle als wie eine Pumpe funktionierten, dass man sie aber auch mit Licht gezielt ansteuern konnte. Dieses Thema verfolgte er dann mit seinen eigenen Leuten fünf Jahre lang bei uns und danach an der Universität Regensburg in den neunziger Jahren unnachgiebig weiter und entdeckte so die oben schon erwähnten sogenannten Kanalrhodopsine. Zu den ersten optogenetischen Experimenten kam es 2005 und hier kommt auch der Neurowissenschaftler Karl Deisseroth ins Spiel, der dritte Preisträger des diesjährigen Lasker-Awards, der sich vor allem mit der Anwendung dieser molekularen Werkzeuge in Nervengeweben befasste. Kurzum, auch hier wird deutlich, welch langen Atem Wissenschaftler brauchen, um aus einem selbstgesteckten Ziel der Grundlagenforschung eine neue Entwicklung anzuschieben!
Ab wann konnten Sie sich vorstellen, dass die von Ihnen entdeckten lichtsensitiven molekularen Pumpen als molekulare Werkzeuge der Neurowissenschaften und der Medizin verwendet werden könnten?
Offen gestanden nie. Die Forschung in unserer Abteilung nahm einfach eine andere Richtung – wir betrieben die dazu notwendige Elektrophysiologie nicht und konzentrierten uns dafür mehr auf das Verständnis des molekularen Mechanismus dieser Pumpen, die in der Zelle als Lichtenergiewandler wie auch als Sensoren funktionierten. Später betrieben wir dazu auch Genomik und Systembiologie. Insofern war die Anwendung in der Optogenetik nicht mein Interesse, auch wenn einige der dafür notwendigen Grundlagen bei uns erforscht wurden – aber eben mit einer anderen Zielsetzung. Später sah ich ein spektakuläres Experiment einer Frankfurter Gruppe: In einem Video konnte man unmittelbar mitverfolgen, wie sich ein Wurm, der Modellorganismus Caenorhabditis elegans, in dessen Muskelzellen man die lichtsensitiven Kanäle aus Algen genetisch eingeschleust hatte, bei Beleuchtung kontrahierte. Diese Studie führte wohl nicht nur mir plastisch das Potenzial der Optogenetik vor Augen – was würde möglich werden, wenn man diese Pumpen und Kanäle etwa in Nervengewebe oder Sinneszellen einbaut! Und dann ging es richtig los – aber zu den Details dieser Forschung müsste man Peter Hegemann und Karl Deisseroth befragen, denn das geschah nach meiner aktiven Zeit.
Die Entdeckung des Bakteriorhodopsins in San Francisco ging wesentlich auch von einer Zufallsbeobachtung an einer besonders gefärbten Substanz aus und lag nicht auf dem Pfad Ihres eigentlichen Forschungsprojekts. Warum sollte man solche Beobachtungen verfolgen? Wenn man in der Logik von Karrieren oder Anträgen denkt, können derartige Exkurse einen ja auch daran hindern, vorab gesteckte Ziele zu erreichen.
Bei mir gibt es darauf schlicht und einfach immer die gleiche Antwort: aus purer Neugier. Wenn ich eine Frage finde, die ich nicht beantworten kann, dann will ich es wissen. Nicht bei jeder Frage, denn meine Neugier bezieht sich auf Phänomene, von denen ich weiß, dass mir voraussichtlich kein Mensch auf der Welt eine Erklärung geben kann. Neugier gepaart mit Neuigkeit – das war immer das, was mich faszinierte. Ich begann bereits als Kind, die Natur aufmerksam zu beobachten, ebenso später im Labor den Ausgang eines Experiments. Ob dieses gelang oder schiefging war sicher befriedigend oder enttäuschend, aber das war eigentlich egal – wichtig blieben Beobachtungen, und zwar vor allem Unerwartetes, von Fehlern wie falschen Voraussetzungen oder Ansätzen einmal abgesehen. In solchen Momenten setzte bei mir beinahe so etwas wie ein „Fresstrieb der Neugierde“ ein: „Warum ist das so, was steckt dahinter? Warum habe ich das beobachtet?“
Ein den Zufall aufgreifende Experimentalstrategie weist eine andere zeitliche Struktur auf als systematisches Experimentieren, denn sie beinhaltet nicht abgearbeitete Projekte, sondern setzt sich eben aus unvorhergesehenen Beobachtungen zusammen, die möglicherweise erst viel später oder in einem anderen Kontext Bedeutung gewinnen oder untersucht werden.
Ganz genau – ich habe mich nie gescheut, manche Beobachtungen wieder aufzugreifen, behielt alles sozusagen immer im Kopf und schaute beispielsweise, ob ein Problem, ein Fund oder ähnliches zu einer Person passte, die eine Doktorarbeit beginnen wollte. Systematisches Arbeiten blieb natürlich genauso wichtig und war sozusagen komplementär zu den Zufallsbeobachtungen. Unsere gesamte Forschung an Halorhodopsin, einem zentralen „Lichtschalter“ der Optogenetik, war systematisch – ich wusste, wir mussten die Struktur des Moleküls erhalten, da ich diese Chloridpumpe mit der Protonenpumpe Bakteriorhodopsin vergleichen wollte – die winzigen Unterschiede beider zu sehen, war faszinierend, ebenso dann die Umwandlungen eines Moleküls bestimmter Funktionalität in das andere: von einer Protonen- in eine Chloridpumpe und von einer Chlorid- in eine Protonenpumpe. Das alles war systematisches Experimentieren. Auch mengenmäßig überwog die Systematik den Zufall. Ich möchte nur immer wieder betonen, dass ich es für wichtig halte, für Zufälliges offen zu sein und auch dem vielleicht unbedeutend Erscheinenden nachzugehen.