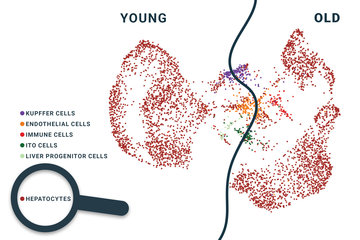Forschungsbericht 2023 - Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften
HIV: Erbgut-Schmuggel in den Zellkern
HIV und AIDS
Auch 40 Jahre nach der Entdeckung des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) als Auslöser von AIDS gibt es zwar Therapien, die das Virus wirksam unter Kontrolle halten, aber noch keine wirkliche Heilung. Um sich zu vermehren, infiziert das Virus Immunzellen und kapert deren genetisches Programm, um sein eigenes Erbgut zu vervielfältigen. Die Immunzellen produzieren dann neue Viren, bis sie schließlich selbst zerstört werden. Der massive Verlust von Immunzellen, die eigentlich der Abwehr von Viren und anderen Krankheitserregern dienen, führt schließlich zu den AIDS-typischen Immundefekten.
Um die Ressourcen seiner Wirtszelle zu nutzen, muss HIV nicht nur die Plasmamembran der Immunzellen überwinden, sondern auch sein Erbgut vom Zytoplasma in den Zellkern bringen. Der Kern aber ist von einer Kernhülle geschützt, die verhindert, dass sich unerwünschte Proteine oder Viren Zutritt verschaffen.
„Intelligentes“ Sortieren in der Kernpore
Dennoch findet ein reger Stoffaustausch zwischen den beiden Kompartimenten Zytoplasma und Zellkern statt. So muss der Zellkern alle seine Proteine aus dem Zytoplasma importieren. Sogenannte Importine erkennen dabei die für den Kern benötigten Proteine, schleusen sie durch die Kernporen der Kernhülle und entlassen sie in den Kern, bevor sie ins Zytoplasma zurückkehren, um die nächsten Frachtmoleküle zu importieren. In der Gegenrichtung transportieren Exportine und andere Transporter Fracht aus dem Kern ins Zytoplasma.
Kernporen agieren dabei als hochselektive und hocheffiziente Proteinsortiermaschinen. Entscheidend ist dabei ein Art „intelligentes“, geleeartiges Material, die sogenannte FG-Phase [1, 2], die für die meisten Makromoleküle undurchdringbar ist. Sie wirkt als Barriere, die den Kernporenkanal ausfüllt und blockiert. Importine und Exportine können aber samt Fracht mühelos hindurchgleiten, weil ihre Oberflächen für die Passage durch eine FG-Phase optimiert sind.
Die Passagen erfolgen innerhalb von Millisekunden. Auch die Transportkapazität ist enorm: Eine einzelne Kernpore kann pro Sekunde bis zu 1000 Transporter passieren lassen [1]. Selbst bei solch hoher Verkehrsdichte bleibt die Barriere der Kernpore intakt und kann unerwünschten Grenzverkehr verhindern. HIV hebelt diese Barriere jedoch in erstaunlicher Weise aus.
Eingeschmuggeltes Erbgut

Wie andere Viren auch, verpackt HIV sein Genom in ein sogenanntes Kapsid. Neuere Experimente deuten darauf hin, dass das virale Erbgut dort verbleibt, bis es die Kernpore passiert hat und im Kern angekommen ist. Dabei gibt es aber ein Größenproblem. Das HIV-Kapsid ist etwa 60 Nanometer breit. Der Durchmesser des Kernporenkanals beträgt 40 bis maximal 60 Nanometer. Damit könnte sich das Kapsid allein gerade noch so durch die Kernpore zwängen. Würde es aber wie eine normale Zellfracht transportiert, müsste es noch von einer Importin-Schicht umhüllt sein, die mindestens weitere zehn Nanometer misst. Mit dieser Schicht wäre das HIV-Kapsid 70 Nanometer breit – zu breit, um in eine Kernpore einzudringen. Von elektronenmikroskopischen Untersuchungen wissen wir jedoch, dass das HIV-Kapsid dennoch in das Innere einer Kernpore gelangt [3]. Wie es dort hineinpasst, war ein bisher ungelöstes Rätsel.
Das Kapsid als Transporter
Wir haben nun entdeckt, dass das Virus sein Größenproblem durch eine raffinierte molekulare Anpassung gelöst hat [4]. Sein Kapsid hat sich zu einem Transporter mit einer Importin-typischen Oberfläche entwickelt. Damit kann es leicht durch die blockierende Barriere ins Innere der Kernpore gleiten, ohne auf helfende Transporter angewiesen zu sein. Mit diesem Trick umgeht das Kapsid einen Schutzmechanismus, der eigentlich verhindern soll, dass Viren in den Zellkern eindringen. Wir haben Methoden etabliert, um die eingangs erwähnten FG-Phasen im Labor zu rekonstituieren [2, 5]. Diese erscheinen im Mikroskop als mikrometergroße Kügelchen, die „normale“ Proteine vollständig ausschließen können, das HIV-Kapsid samt Inhalt aber, bildlich ausgedrückt, einsaugen. Ebenso wird das Kapsid in den eigentlichen Kernporenkanal menschlicher Zellen hineingesogen, und dies passiert auch, wenn zuvor sämtliche Importine der Zelle entfernten wurden (Abb. 1).
Bei aller Ähnlichkeit mit den zelleigenen Transportern unterscheidet sich das HIV-Kapsid in einem Detail grundlegend von allen bisher untersuchten Transporterklassen. Es kapselt seine Fracht vollständig ein und verbirgt so das transportierte Erbgut vor den sonst sehr effektiven antiviralen Sensoren im Zytoplasma. Praktisch unsichtbar kann das virale Genom so durch die zelluläre Virusabwehr geschmuggelt werden, ohne erkannt und zerstört zu werden. Das HIV-Kapsid stellt damit, nach den Importinen und Exportinen, eine neue Klasse von molekularen Transportern dar (Abb. 2).

Wie das Virus-Erbgut schließlich aus dem Kapsid im Zellkern freigesetzt wird, ist noch unklar. Ob das Kapsid dafür tiefer in den Zellkern eindringt oder bereits in der Nähe beziehungsweise innerhalb des Kanals zerfällt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, müssen weitere Experimente zeigen.
HIV gehört zu den sogenannten Retroviren, von denen die meisten nur diejenigen Zellen infizieren, die sich gerade teilen. Sie können den Kern also nur erobern, wenn sich die Kernhülle bei der Zellteilung vorrübergehend auflöst. Für seine Strategie, Immunzellen zum eigenen Schutz bis hin zur Immunschwäche auszuschalten, ist HIV jedoch auf die Infektion ruhender Zellen angewiesen, da die meisten Immunzellen des Körpers nicht in Teilung begriffen sind. Der Erbgut-Schmuggel innerhalb eines „Transporter-Kapsids“ durch eine intakte Kernhülle hindurch scheint daher ein zentraler Teil dieser Strategie und damit eine Voraussetzung für den bedrohlichen Erfolg dieses Erregers zu sein. Diese neue Erkenntnis könnte vielleicht Ansatzpunkte für neue therapeutische Konzepte liefern.