Unmittelbare Inspiration
Die Empathieforscherin Esther Kühn pendelt zwischen dem Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und dem University College London hin und her. Sie empfindet diese Zusammenarbeit als äußerst fruchtbar.
Wer ab und zu auf einem wuseligen Flughafen wie Heathrow Airport landet, weiß, wie sehr uns die moderne Welt mit Menschen verbindet – zumindest scheint es so. Geschäftsreisende eilen zu Terminen, sie stolpern, rempeln sich an und entschuldigen sich. Weit gereiste Großeltern tragen ihre Enkel auf dem Arm. Liebende warten auf den einen besonderen Menschen, der bald durch diese Schiebetür kommt und der vielleicht ein bisschen zu lange weg war.
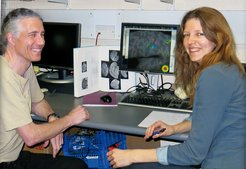
Doch wie bauen Menschen eigentlich diese Verbindungen zueinander auf? Welche Bereiche unseres Gehirns sind dabei aktiv und wie? Diese Frage hat eine lange Tradition in der Empathieforschung, und sie begleitet mich seit geraumer Zeit. Um genau zu sein, interessiert mich besonders ein winziger Teilaspekt: Was passiert im Gehirn, wenn jemand berührt wird? Und was, wenn er lediglich beobachtet, wie ein anderer Mensch berührt wird?
Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich auf die Suche nach geeigneten Verbindungen zu anderen Forschern gemacht. Am Max-Planck-Institut in Leipzig steht schon das richtige Gerät, ein Magnetresonanztomograf, und auch die richtigen Probanden sind da. Während sie in der MRT-Röhre lagen, strich ich ihnen mit einem Pinsel über die Finger – oder sie guckten Filme der gleichen Bewegung an einem anderen Menschen. Während dieser Experimente entstanden allerdings riesige Datenmengen – und diese richtig auszuwerten ist eine große Herausforderung.
Zum Glück habe ich während eines ersten Forschungsaufenthalts in England meinen Kollegen Patrick Haggart vom University College London kennengelernt. Wenn ich in Leipzig manchmal nicht weitergekommen bin, haben wir über Skype diskutiert, auch schon mal nach Feierabend. Und wir haben zusammen überlegt, wie wir mit meinen Daten am besten umgehen. Irgendwann sagte er: „Könntest du deine Fragen nicht besser beantworten, wenn du das Programm meines Kollegen Martin Sereno hier in London anwenden würdest?“ Natürlich! Seitdem verbringe ich ein paar Monate im Jahr in der britischen Hauptstadt. Jetzt könnte man meinen, ich bräuchte in London gerade mal einen Computer und eine gefüllte Kaffeetasse. Aber das stimmt nicht ganz. Denn ich sitze in meinem Büro zusammen mit Martin, der Marty genannt wird, und ich ziehe viel Inspiration aus dem direkten Austausch mit ihm – ein Riesenvorteil! Immerhin ist er ein renommierter Neurowissenschaftler und das Programm, mit dem wir arbeiten, sein Baby.
Mittlerweile habe ich sogar neue Ideen bekommen, die mit meinem ursprünglichen Projekt gar nichts zu tun haben. Ein Riesenvorteil für eine Nachwuchswissenschaftlerin. Es ist für mich eine enorme Bereicherung, dass mein Kollege genauso viel Energie und Enthusiasmus für mein Projekt hat und sich so viel Zeit dafür nimmt, bevor er dann zum Feierabend mit seinem Rennrad durch die eher fahrraduntaugliche Londoner Innenstadt nach Hause rast. Dann heißt es für mich: Auf zu Pilates oder zum Schwertkampfkurs! Denn wer will schon den ganzen Tag am Bildschirm hocken?
Jetzt habe ich insgesamt schon gut ein Jahr in London verbracht. Und obwohl ich mich als Leipzigerin für kulturverwöhnt halte, ist London schon eine enorme Steigerung. Die Stadt bietet mir alle Möglichkeiten, und manchmal werde ich fast erschlagen von dem kulturellen Angebot. Erst kürzlich war ich wieder auf Konzerten und im klassischen Ballett. Ich brauchte aber tatsächlich eine ganze Weile, bis ich meinen Platz hier gefunden habe. London ist eine logistische Herausforderung und verändert sich einfach total schnell. Beispielhaft dafür ist, dass ich selbst heute noch nicht einschätzen kann, wie lange ich für einen Weg brauche – ich bin einfach ständig zu spät.
Wenn ich nach meinen Londoner Abenteuern dann wieder am Flughafen Leipzig/Halle lande, fühlt sich alles viel kleiner an. Ich würde sagen, im Vergleich zu London ist Leipzig mein Wohnzimmer. Mein Zuhause. Aber ich bin jetzt verändert und voller neuer Ideen. Und auch wenn mein zukünftiger Forschungsort noch nicht ganz feststeht, bin ich mir sicher: Meine Zukunft in der Wissenschaft hat begonnen.












