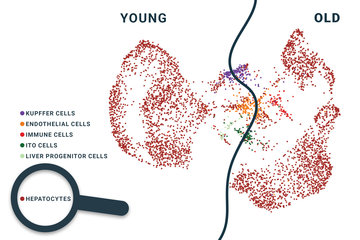Elixiere aus der Ursuppe
RNA-Moleküle mit Enzymwirkung haben vermutlich bei der Entstehung von Leben auf der Erde eine zentrale Rolle gespielt
In der Bibel entsteht die Schöpfung Schritt für Schritt: erst das Licht, dann Wasser und Land bis hin zu den Landtieren und dem Menschen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Bestandteile des Lebens aber vielleicht nicht nacheinander, sondern gleichzeitig entstanden – davon ist zumindest Hannes Mutschler am Max-Planck-Institut für Biochemie überzeugt. In Martinsried bei München erforschen er und seine Kollegen, welche Rolle RNA-Moleküle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben.
Text: Claudia Doyle

Lassen Sie uns auf eine Zeitreise zu den Anfängen unseres Planeten gehen. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren war die Erde ein äußerst unwirtlicher Ort: ihre Oberfläche ein glühendes Meer aus geschmolzenem Gestein, der Himmel erfüllt von Meteoriten, die unablässig aus dem All herabregneten und tiefe Krater in den Boden rissen, und die Atmosphäre eine Mischung aus Kohlendioxid, Ammonium und Methan. Lebewesen? Fehlanzeige – nicht in diesem Inferno.
Während der nächsten Milliarde Jahre beruhigte die Erde ihr hitziges Gemüt. Sie kühlte ab, Ozeane und Kontinente entstanden. Und irgendwo im Wasser nahm das Leben seinen Anfang: Aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff oder Stickstoff wurden komplexe Moleküle, die ersten Zellen entstanden. Aber wie genau ist das alles abgelaufen?
„Wir können natürlich nicht die Zeit zurückdrehen. Deshalb ist es so schwer herauszufinden, wie es wirklich war“, sagt Hannes Mutschler, der am Max-Planck-Institut für Biochemie die Gruppe für Biomimetische Systeme leitet. „Wir versuchen daher, den Ursprung des Lebens im Labor nachzustellen – unter Bedingungen, wie sie in der Frühphase des Lebens auf der Erde herrschten.“
Zellen aus Menschenhand

Seine Kollegen und er wollen künstliche Systeme herstellen, die sich wie lebende Zellen verhalten. Das kann man auf zwei unterschiedlichen Wegen erreichen. Entweder man nimmt eine bereits existierende Zelle und entfernt nach und nach alle nicht lebensnotwendigen Teile. So macht das zum Beispiel der US-amerikanische Wissenschaftler und Unternehmer Craig Venter, der Anfang des Jahrtausends maßgeblich an der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts beteiligt war. Oder man wählt so wie Hannes Mutschler den umgekehrten Weg und erschafft eine Zelle von Grund auf neu.
Mutschler und sein Team wollen Teile einfacher „Protozellen“ mit einer Minimalausstattung aus Enzymen, Zellhülle und Nukleinsäure-Erbgut nachbauen. Als Erstes müssen die Wissenschaftler die molekularen Bausteine identifizieren, die notwendig sind, damit eine Zelle lebensfähig ist. Und dann fügen sie Baustein für Baustein im Reagenzglas richtig zusammen. „Das gleicht der Arbeit mit einem riesigen Lego-Baukasten“, sagt Mutschler. Das Problem dabei ist, dass niemand genau zu sagen vermag, was eine minimalistische Zelle überhaupt zum Leben braucht. Die Evolution hat über Millionen Jahre hinweg zahlreiche Prozesse schrittweise weiter verbessert und miteinander verflochten.
Schaut man heute in eine moderne Zelle hinein, kann man nur schwer auseinanderhalten, welche der vielen Abläufe überlebenswichtig sind und welche ersetzbar. „Das ist so, als ob Sie ein modernes Auto auseinandernehmen und dann vor einem Haufen Blech, Kabel und Elektronik stehen“, sagt Mutschler. Nicht alles wird gebraucht, damit das Auto fahren kann, aber welches die unersetzlichen Komponenten sind, lässt sich nicht so einfach erkennen. Selbst bei einzelnen Molekülkomplexen ist oft unklar, welche Bestandteile essenziell sind. Ein Beispiel ist das Ribosom: Diese molekulare Maschine nutzt die Erbinformation der Zelle als Vorlage und setzt Aminosäuren in der richtigen Reihenfolge zu Proteinen zusammen. Der Aufbau des Ribosoms ist sehr komplex: Mehr als 100 Gene sind an seiner Bildung beteiligt. Geht das nicht auch einfacher? Vermutlich. Aber wie, das weiß bisher niemand.
Bis heute ist die Wissenschaft über die ersten Schritte des Lebens uneins. Manche Forscher vermuten, dass ein einfacher Stoffwechsel der Anfang von allem war. Leben zeichnet sich schließlich dadurch aus, dass es Energie umwandeln und zu seinem Erhalt und seiner Vermehrung einsetzen kann. Als Energiequellen könnten beispielsweise Unterschiede in der Konzentration positiv geladener Wasserstoffatome gedient haben. Solche sogenannten Protonengradienten entstehen zum Beispiel dort, wo saures Wasser der frühen Ozeane auf basisches Wasser heißer unterirdischer Quellen trifft. Genetische Analysen haben gezeigt, dass sehr ursprüngliche Stoffwechselreaktionen ihre Energie tatsächlich aus Protonengradienten gewinnen.
Aber können Stoffwechselmoleküle überhaupt frei und ungeschützt existieren und arbeiten, oder müssen sie durch eine Hülle geschützt und zusammengehalten werden? Denn was nützt es, wenn sich erste komplexe Moleküle bilden, die aber im offenen Meer davontreiben? Manche Forscher vertreten aus diesem Grund den Standpunkt, dass winzige Tröpfchen aus Fettmolekülen als Vorläufer heutiger Zellmembranen das Leben auf der Erde erst möglich gemacht haben.
Molekülhaufen statt Zellmembran

Solche Membranen müssen stabil sein, sich teilen können und kontrollieren, welche Substanzen hinein- und hinausbefördert werden. Eventuell ist dafür aber zunächst keine Zellmembran wie bei heutigen Zellen notwendig. Kleine Molekülhaufen, deren Moleküle durch elektrostatische Kräfte zusammengehalten werden – sogenannte Koazervate –, könnten in einem ersten Schritt die Aufgaben einer Zellmembran übernommen haben. Diese Vermutung zu belegen ist eines der Ziele von Mutschlers Forschung: Zusammen mit zwei weiteren Arbeitsgruppen vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden untersuchen die Martinsrieder Forscher, ob einfache Biopolymere in Koazervaten ohne Membran existieren und Reaktionen katalysieren können. Für andere Forscher stand dagegen die Weitergabe von Information von einer Generation an die nächste am Beginn allen Lebens. Aber wie sah diese Weitergabe aus?
Heute übernimmt diese Aufgabe das Molekül Desoxyribonukleinsäure (DNA). Teilt sich eine Zelle, so verdoppelt sich auch die DNA. Jede Tochterzelle erhält eine DNA-Kopie und damit die komplette Erbinformation. Doch viele Wissenschaftler halten es für unwahrscheinlich, dass das Erbgut am Anfang des Lebens aus DNA bestand. Stattdessen favorisieren einige das Molekül Ribonukleinsäure (RNA), das Zellen heute als Mittler für die Bildung von Proteinen benutzen. Diese RNAs sind gewissermaßen Abschriften der DNA, die aus dem Zellkern zu den Ribosomen im Zellplasma wandern und die Vorlagen für die Bildung von Proteinen liefern.
Ursprünglich aber könnte RNA nicht nur ein Zwischenprodukt, sondern der eigentliche Speicherort der Erbinformation gewesen sein. Ihr Vorteil: Sie kann sich im Gegensatz zu DNA leichter in dreidimensionale Formen falten. Dadurch bildet sie ähnlich wie moderne Proteine Strukturen, die als natürlicher Katalysator chemische Reaktionen beschleunigen. Diese als Ribozyme bezeichneten RNAs sind zwar in der Regel nicht so effizient wie Proteinenzyme, doch in Zellen sind trotzdem Tausende davon aktiv und absolut zentral für das Überleben einer jeden Zelle. So wird beispielsweise das katalytische Zentrum des Ribosoms ausschließlich von RNA gebildet – es ist also ein Ribozym. Das Ribosom könnte daher sogar ein Relikt aus einer vergangenen biolo-gischen Ära sein, der sogenannten RNA-Welt – eine Welt, in der RNA eine Doppelfunktion erfüllt hat: als Informationsspeicher und als Katalysator chemischer Reaktionen.
Aber wie haben sich die längeren RNA-Moleküle gebildet, aus denen die ersten Ribozyme entstanden sind? Auf der frühen Erde haben sich die Einzelbausteine, die sogenannten Nukleotide, spontan vermutlich nur zu sehr kurzen RNA-Molekülen verbunden. „Mit so kurzen Schnipseln lässt sich noch nicht viel anfangen, die meisten RNA-Moleküle in den Zellen sind länger“, sagt Mutschler. Wie sich aber die für Ribozyme erforderlichen längeren Ketten bilden konnten, war lange unklar. In seiner Zeit als Postdoc am Laboratory of Molecular Biology in Cambridge hat Mutschler herausgefunden, dass sich diese Schnipsel unter den richtigen Bedingungen selbst zu komplexen RNA-Ketten zusammenknüpfen können.
Einfrieren und Auftauen

Besonders erfolgversprechend scheint demnach zu sein, eine salzhaltige Lösung mit RNA-Molekülen mehrmals hintereinander einzufrieren und wieder aufzutauen. Der Forscher gibt dazu kurze, am Computer entworfene RNA-Abschnitte in salzhaltiges Wasser. Dann kühlt er diese Lösung langsam ab. Die Flüssigkeit beginnt zu gefrieren. Zunächst bilden sich Eiskristalle aus nahezu reinem Wasser, die positiv und negativ geladenen Salzionen verbleiben dagegen in der Flüssigkeit. Die fragile RNA mag diese Umgebung: Die Ionen geben ihr Stabilität, helfen beim richtigen Falten und fördern die Bindung und Verknüpfung einzelner RNA-Fragmente.
Dann taut Mutschler die Lösung wieder auf. Die RNA-Stränge, gerade eben noch präzise angeordnet und über sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen untereinander zusammengehalten, lösen sich voneinander und schwimmen wieder frei umher. Beim nächsten Gefriervorgang ordnen sie sich neu und werden verknüpft. Etwa zwölfmal muss Mutschler das wiederholen, bis sich ein Strang von etwa 200 Bausteinen Länge gebildet hat. „Vermutlich würde der Vorgang auch von allein ablaufen, aber viel zu langsam. Das wiederholte Einfrieren und Auftauen beschleunigt die Verknüpfung erheblich“, erklärt Mutschler.
Doch ein langer RNA-Strang reicht allein noch nicht aus, um damit Informationen an die nächste Generation weiterzugeben. Die RNA muss sich zudem selbstständig verdoppeln können. In modernen Zellen bekommt sie dabei Hilfe von einem Enzym namens RNA-Polymerase. Doch vielleicht war das nicht immer so. Momentan testet Mutschler deshalb, ob durch das wiederholte Einfrieren und Auftauen auch ein Ribozym mit Kopierfunktion entstehen kann.
Die Temperaturschwankungen haben darüber hinaus noch einen weiteren Effekt: Sie können offenbar eine einfache Art der Übertragung von genetischem Material zwischen Protozellen auslösen: Winzige mit Erbgut gefüllte Fetttropfen lagern sich beim Einfrieren aneinander und tauschen ihren Inhalt untereinander aus.
Mit seinen Experimenten hat Mutschler im Labor demonstriert, was wiederholte Zyklen aus Gefrieren und Auftauen bewirken können. Jetzt muss er zeigen, dass solche Vorgänge auch unter den Umweltbedingungen vor über 3,5 Milliarden Jahren ablaufen können, denn so alt sind die ältesten bisher bekannten Bakterienfossilien. Weil es auf der jungen Erde ziemlich chaotisch zuging, existierten die unterschiedlichsten Lebensräume. „Das ist Fluch und Segen zugleich“, sagt Mutschler. Einerseits können Wissenschaftler dadurch zahlreiche Umwelteinflüsse testen, andererseits ist die Liste extrem lang, angefangen von hydrothermalen Quellen in der Tiefsee bis zu Meteoritenkratern.
Da für viele chemische Reaktionen auch UV-Licht notwendig ist, vermutet Mutschler, dass das Leben eher an der Oberfläche eines Gewässers als in der Tiefsee entstanden ist. Er favorisiert heiße Quellen in kalter Umgebung, ähnlich wie auf Island: „Im heißen salzhaltigen Wasser der Quellen können leicht einfache Moleküle entstehen, die sich dann gleich daneben in der Kälte zu komplexeren Molekülen zusammenlagern.
Urerde im Labor

Jetzt möchten Mutschler und seine Kollegen die Sache auch experimentell angehen. Dafür kooperiert er mit der Arbeitsgruppe von Paola Caselli vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Dort stehen Reaktionskammern, mit denen die Wissenschaftler den Ursprung organischer Verbindungen im Weltall erforschen. Genauso gut können sie darin aber auch die Bedingungen auf der unbelebten Erde simulieren. Umweltbedingungen wie Temperatur, Wellenlänge des Lichts oder Zusammensetzung der Atmosphäre lassen sich exakt einstellen und beliebig variieren. Mutschler möchte auf diese Weise herausfinden, wie stabil RNA unter präbiotischen Bedingungen ist und ob dabei Katalyse und Evolution stattfinden können.
Immer mehr setzt sich unter den Wissenschaftlern die Einsicht durch, dass Erbinformation, Stoffwechsel und Zellhülle nicht für sich allein zu lebenden Zellen führen konnten. Vielmehr sind vermutlich alle drei Bausteine parallel entstanden. Es erscheint zwar zunächst naheliegend, die Bestandteile des Lebens einzeln nacheinander zu erschaffen. Aber häufig funktionieren die sorgsam ausgetüftelten Reaktionen nicht. Sie kommen erst in Fahrt, wenn sich im Reaktionsgemisch genau die richtige Dosis an Hilfsstoffen und Nebenprodukten befindet. Es ist folglich wahrscheinlich, dass unterschiedlichste Moleküle mehr oder weniger gleichzeitig entstanden sind.
Die Entstehung des Lebens ist folglich womöglich ungeordneter abgelaufen als in den Reagenzgläsern der Forscher. Diese Vorstellung gefällt auch Mutschler. „Ich bin zwar ein Anhänger der Hypothese, dass RNA am Anfang des Lebens eine zentrale Aufgabe als Informationsspeicher und Biokatalysator übernommen hat. Aber ich glaube auch, dass RNA niemals allein war und gleich zu Beginn Hilfe von anderen Biomolekülen erhalten hat.“
Für den Erfolg der Erforschung der Ursprünge des Lebens wird also künftig entscheidend sein, Chaos in den Reagenzgläsern zuzulassen – aber nur gerade so viel Unordnung wie für das Leben nötig.
Auf den Punkt gebracht
- Wissenschaftler wollen wissen, welche Bausteine unbedingt erforderlich sind, damit eine Zelle lebensfähig ist. Dazu versuchen sie, eine Zelle mit einer Minimalausstattung aus Proteinen, Membranmolekülen und DNA oder RNA nachzubauen.
- Durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen können Forscher im Labor 200 Bausteine für RNA-Moleküle zu längeren Strängen aneinanderfügen. Auf der Urerde könnten die ersten längeren RNA-Moleküle also in
- heißen Quellen in kalter Umgebung entstanden sein.
- Möglicherweise sind die wesentlichen Komponenten des Lebens – Erbinformation, Stoffwechsel und Zellhülle – nicht nacheinander, sondern mehr oder weniger gleichzeitig entstanden.
Glossar
Koazervate:
Zusammenlagerungen von Makromolekülen, die durch elektrostatische Kräfte zwischen entgegengesetzt geladenen Molekülen zusammengehalten werden. In den einen Tausendstel- bis einen Zehntelmillimeter großen, meist kugeligen Gebilden können chemische Reaktionen weitgehend geschützt vor äußeren Einflüssen ablaufen.
Ribozyme:
Neben Proteinen (Enzymen) können auch manche RNA-Moleküle biochemische Reaktionen beschleunigen. Solche Ribozyme be-zeichnen neben katalytisch wirksamen RNA-Molekülen auch Proteine, an die eine RNA mit katalytischen Eigenschaften gebunden ist. Als Kataly-satoren senken Ribozyme die Aktivierungsenergie chemischer Reaktionen und lassen diese dadurch um ein Vielfaches schneller ablaufen. Ribozyme sind Kandidaten für die ersten sich selbst kopierenden biologischen Makromoleküle auf der Erde, da sie als Informationsträger und -überträger sowie als Katalysatoren chemischer Reaktionen fungieren können.